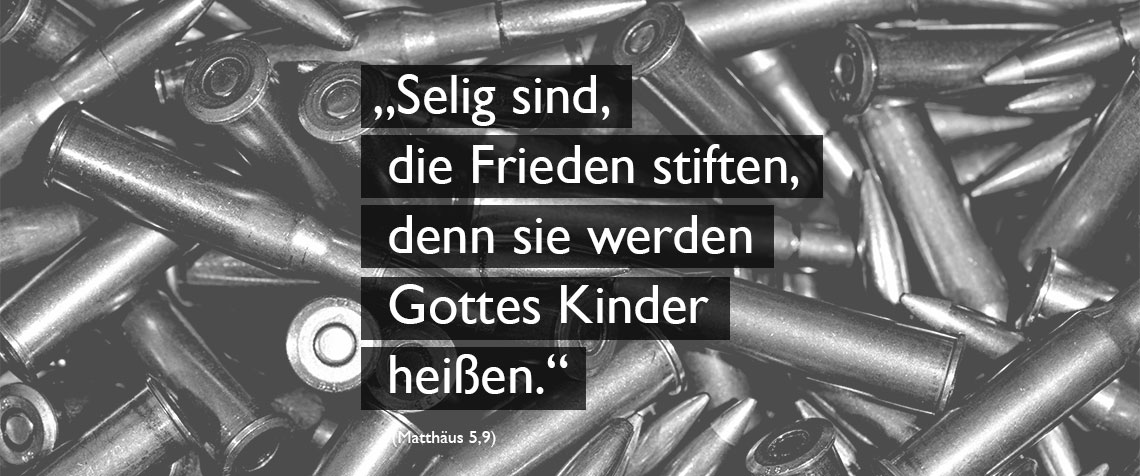Kassel/Sibui/Bad Hersfeld/Flieden/Niedergründau/Hannover (medio/epd). Der Krieg in der Ukraine stellt die christliche Haltung zum Frieden auf eine harte Probe. Im Jahr 2007 formulierte die Evangelische Kirche in Deutschland noch für sich: Mit militärischen Mitteln lasse sich kein Frieden herstellen und zivile Konfliktbearbeitung müsse an erster Stelle stehen. Nicht ins Militär, sondern in den Frieden solle investiert werden und in Krisengebiete dürften keine Waffen mehr geliefert werden. Damals war nicht zu erahnen, dass Russland ein Nachbarland angreift, um es zu erobern. Mit dem Ukraine-Krieg wird nun auch das Dilemma immer sichtbarer: inwieweit es im Blick auf das Evangelium von Jesus Christus zu rechtfertigen ist, dem Frieden mit militärischer Gewalt den Weg zu bereiten. Die Debatte ist vielschichtig.
Dilemmata beschreiben, Verantwortung übernehmen und Fragen nach den «roten Linien» stellen
«Der Krieg, den Putin führt, dieser Krieg ist nicht gerecht, aber der Verteidigungskrieg, den die Ukraine zu ihrer Verteidigung gegen diese Aggression führt, der ist gerechtfertigt», sagte Bischöfin Dr. Beate Hofmann in Hermannstadt (rumänisch Sibiu) bei einem Partnerschaftsbesuch bei der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (A.B.) in Rumänien. Zu den Grundlinien einer verantwortungsethischen Position zum Ukraine-Krieg gehöre, die Dilemmata (beispielsweise Waffenlieferungen und Sanktionen) zu beschreiben, mit der Realität im Blick Verantwortung zu übernehmen sowie Fragen nach den «roten Linien» und dem, was aus dem Blick gerät, zu stellen, so Hofmann in einem Vortrag am Theologischen Institut in Hermannstadt.
Die Auseinandersetzung mit dem Krieg habe auch eine spirituelle Seite, nämlich sich dem Hass zu verweigern: «Ich sehe darum eine wichtige Aufgabe darin, als Kirche an der Entfeindung zu arbeiten», wirbt Bischöfin Hofmann. Dazu zähle der Dialog mit Menschen aus Russland und aus der orthodoxen Kirche. Es gelte, alle Wege zu nutzen, «um zu zeigen, dass wir diesen Krieg nicht wollen, dass wir aber auch eine andere Sicht auf die Dinge haben als Putin. All das dient dazu, die Brücken aufrechtzuerhalten».
Bischöfin Dr. Hofmann im Interview: «Wir sind in einem Dilemma»
Welche Haltung hat die Kirche zum Krieg in der Ukraine und zum Thema Waffenlieferungen? Was können Christinnen und Christen jetzt für Geflüchtete und für den Frieden tun? Und was passiert gerade ganz konkret an Hilfsaktionen? Darüber hat Doris Renck vom Radiosender hr-Info am 22.3.22 mit Bischöfin Dr. Beate Hofmann gesprochen (Copyright by hr-iNFO):
«Kirche darf sich nicht aufs Beten zurückziehen»
Die Kirche sei in der Pflicht, Orientierung zu geben und nicht zu schweigen, sagte der SPD-Politiker Michael Roth aus dem osthessischen Heringen am Mittwochabend (13.4.) mit Blick auf den Ukraine-Krieg. In einem Onlinegespräch mit Bischöfin Dr. Hofmann forderte er: «Kirche darf sich nicht aufs Beten zurückzuziehen, sie muss Flagge zeigen, die Konflikte austragen und sich versöhnend-konstruktiv einbringen.» Roth sagte: «Wir werden einen Frieden nur mit Waffen schaffen.» Deutschland müsse einen Beitrag leisten: «Nur damit können wir Leben retten.»
Für Waffenlieferungen spreche aus Sicht von Bischöfin Dr. Hofmann das Ziel, die «mutige Selbstverteidigung der Ukrainer zu unterstützen». Sie verlängerten jedoch den Krieg, trieben die Gewaltspirale an und töteten Menschen. Dilemmata wie diese zu benennen, sei Aufgabe der Kirche. Eine weitere sei es, Unrecht zu benennen und nicht zu verharmlosen, aber deutlich zu machen: «Wenn ich verurteile, was ein Mensch tut, heißt das nicht, dass ich ihn nicht mehr als Menschen sehe», so Hofmann
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und die Bischöfin diskutierten in der Reihe «Was bewegt?» zum Thema «Der Krieg in der Ukraine und unsere Haltung zum Frieden», die von der Evangelischen Akademie in Hofgeismar angeboten wird. Einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung finden Sie hier.
Müssen differenziertes Denken und Argumentieren in der Friedensethik neu lernen
Auch die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck setzen sich mit dem Thema Friedensethik auseinander. Als junge Frau habe sie wie viele andere die Aufkleber «Schwerter zu Pflugscharen» gehabt und sei lange davon überzeugt gewesen, dass Frieden nur ohne Waffen geschaffen werden könne, so die Pröpstin des Sprengels Hanau-Hersfeld, Sabine Kropf-Brandau, gegenüber dem Medienhaus der EKKW. «Das hat sich für mich geändert. Natürlich auch mit einem Bedauern. Gar keine Frage.»
Die Realität sei nun anders: «Wir erleben eine Welt voller Gewalt. Und ich finde, wir dürfen als Christinnen und Christen diese Radikalität und Realität des Bösen und der Sünde nicht einfach überspringen.» Ihr habe der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gezeigt, dass es Grenzfälle gibt, in denen Recht, Frieden und Freiheit nur durch Gewaltanwendung überhaupt hergestellt oder geschützt werden können. «Gewalt ist für mich die letzte Möglichkeit. Ich glaube aber, rettenden Gewalt kann auch ein Akt der Nächstenliebe und der Nothilfe sein», sagt Kropf-Brandau.
Pröpstin Sabine Kropf-Brandau aus Bad Hersfeld
Pfarrer Holger Biehn aus Flieden will den Grundsatz «Frieden schaffen ohne Waffen» und Gottes Idee von einer friedlichen Welt nicht aufgeben. Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, wie schnell «ein Verrückter mit großem Einfluss» diese Idee zerstören könne, so der Pfarrer. Es stimme ihn hoffnungsvoll, dass über diesen Krieg kaum jemand jubelt: «Selbst Putin scheint sein Eroberungsanliegen vor seinem Volk zu verheimlichen und klein zu reden». Und dass auch in Deutschland verzagt gehandelt und «herumlaviert» werde, findet Biehn «absolut angemessen».
Pfarrer Holger Biehn aus Flieden
Pfarrer Ralf Haunert aus Niedergründau fragt sich schon länger, ob «wir es uns nicht manchmal zu einfach machen» und verweist dabei auf kirchliche Positionen zu politischen Themen. «Wenn die EKD-Synode in einer Entschließung im November 2019 gesagt hat 'Gewaltfreiheit stehe für evangelische Friedensethik an erster Stelle' und (...) von einem aktiven Gewaltverzicht redet (...), dann frage ich mich, ob das angesichts dessen, was wir gegenwärtig erleben, noch eine haltbare Position ist und ob es das jemals war.» Die Ukrainer setzten sich mit allem, was sie haben, zur Wehr, um ihr Land und ihre Freiheit zu verteidigen. «Ich kann und will nicht anders, als ihnen dabei Erfolg zu wünschen.» Für ihn ist es richtig, dass der Westen den Ukrainern Waffen zur Selbstverteidigung liefert. «Und trotzdem wünsche ich mir Frieden», so Haunert und fordert: «Wir müssen als Kirche differenziertes Denken und Argumentieren in der Friedensethik neu lernen, wenn wir im gesellschaftlichen Diskurs ein ernstzunehmender Gesprächspartner sein wollen.»
Pfarrer Ralf Haunert aus Niedergründau
EKD-Kirchenkonferenz: «Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg»
Die 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland betonen ebenfalls das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine im Krieg mit Russland: «Das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine im Blick auf die gegen sie gerichteten Aggressionen ist unbestritten», heißt es in einer Ende März veröffentlichten Erklärung der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der die Kirchenleitenden regelmäßig zusammenkommen. Frieden sei dennoch letztlich nicht mit Waffengewalt herzustellen. «Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg.» Ohne Vertrauen, Gerechtigkeit und persönliche Kontakte zwischen Menschen aller Völker sei Frieden nicht möglich, betonen die Kirchenleitenden. «Wir werden alles in unserer Möglichkeit Stehende tun, um die Menschen in der Ukraine und Geflüchtete zu unterstützen», versprachen sie. Dazu zähle die Fürbitte genauso wie die Seelsorge an Traumatisierten, der Einsatz für besonders verletzliche Menschen und alle Unterstützung für diplomatische und nicht-militärische Wege. Es müsse zudem dafür Sorge getragen werden, dass in der Gesellschaft keine Spaltung zwischen verschiedenen Gruppen von Geflüchteten entsteht. (13.04.2022)
Stichwort: Evangelische Friedensethik
Frieden ist ein zentrales Thema des christlichen Glaubens und naturgemäß ein Kernthema der Kirche. In jedem Gottesdienst wird für den Frieden gebetet, am Ende werden die Herzen und Seelen der Gläubigen dem Frieden Gottes anempfohlen. In der Nachkriegszeit wurde die kirchliche Lehre vom «gerechten Krieg», wonach Krieg unter gewissen Bedingungen gerechtfertigt ist, endgültig verworfen. Die evangelische Kirche schloss sich dem Gewaltverbot in der Charta der Vereinten Nationen an, nachdem der deutsche Protestantismus im Ersten und Zweiten Weltkrieg die preußischen beziehungsweise nationalsozialistischen Machthaber im Krieg unterstützt hatte.
«Auf der Gewalt ruht kein Segen, und Kriege führen nur tiefer in die Bitterkeit, Haß, Elend und Verwahrlosung hinein. Die Welt braucht Liebe nicht Gewalt, sie braucht Frieden nicht Krieg» - mit diesen Worten erteilte die erste Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Jahr 1948 dem Krieg als Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen eine Absage. Dabei ist es bis heute geblieben. Doch der russische Angriff auf die Ukraine hat in der evangelischen Kirche eine Debatte angestoßen, ob die protestantische Friedensethik erneuert werden muss. Denn der kirchliche Friedensappell mit Aufrufen zum Gebet ist vielen zu blass angesichts eines gewaltsam vorgehenden russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Oft steht die evangelische Kirche in dem Verdacht, einem prinzipiellen Pazifismus anzuhängen. Die protestantische Friedensethik steht vielmehr im Spannungsfeld zwischen Pazifismus und dem, was der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber einmal als «Verantwortungspazifismus» bezeichnet hat. 2007 war er als Ratsvorsitzender einer der Verantwortlichen der zweiten EKD-Friedensdenkschrift, die das Leitbild des «gerechten Friedens» etabliert hat, das seither als Kernstück protestantischer Friedensethik gilt.
Die Denkschrift stellte klar, dass zur Wahrung und Wiederherstellung des Rechts unter Umständen auch der Einsatz militärischer Gewalt ethisch legitimierbar ist. Sie folgt dem Grundsatz, militärische Mittel nur als Ultima Ratio einzusetzen, und betont den Primat der friedlichen Konfliktlösung. Darin unterscheidet sich die Denkschrift von einem radikalen Pazifismus.
Über die Jahre hat sich die evangelische Friedensethik fortentwickelt. 2019 auf der EKD-Synode in Dresden betonten die Delegierten etwa, dass ein stärkerer Fokus auf Klimagerechtigkeit gelegt werden müsse. Angesichts eines Angriffskriegs in einem europäischen Land muss sich zeigen, ob die protestantische Friedensethik Antworten geben kann auf die praktischen Herausforderungen der Friedenspolitik.
Themenschwerpunkt:
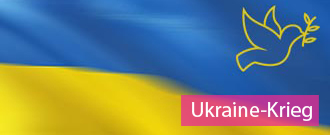
Im ekkw.de-Themenschwerpunkt zum Ukraine-Krieg finden Sie wichtige Hinweise und Empfehlungen zur Unterstützung von Geflüchteten und weitere Meldungen und Berichte.